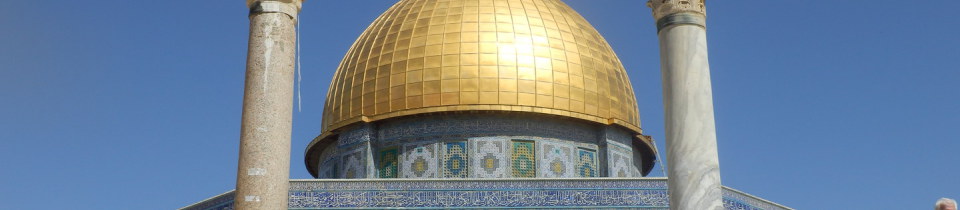
Geschichte aktuell
Gefürchtet und bewundert: Die Wikinger
Anfangs hatten die Wikinger in Europa keinen guten Ruf. Sie seien gewissenlose Räuber und Plünderer, barbarisch, ohne jede Kultur und Zivilisation, hieß es. Doch für sie selbst waren die Züge über das Meer lebensnotwendig. In ihrer skandinavischen Heimat herrschte Armut. Fruchtbares Ackerland war rar gesät, das Erbrecht benachteiligte zudem die jüngeren Söhne, da alles an den Ältesten fiel. Viele sahen in den Kaper- und Beutefahrten über das Meer den einzigen Ausweg, ihre Existenz zu sichern.
Je erfolgreicher die Wikinger waren, desto größer wurde der Radius ihrer Aktionen. Sie verließen ab dem 9. Jahrhundert die vertrauten Gewässer des Nordens und steuerten ihre Wunderschiffe in unbekannte Gestade bis nach Nordafrika und an das Kaspische Meer. Manche tauschten das unstete Leben des Seefahrers gegen die produktive Existenz sesshafter Bauern ein. Zu diesem Zweck nahmen sie bei ihren Touren ganze Landstriche an den Küsten in Besitz. Doch die meisten ließ das Meer nicht los. Sie erkannten, dass man auch ohne Raub erfolgreich sein kann. So wandelten sich viele Wikinger von Piraten zu ehrbaren Kaufleuten. Und in dieser Eigenschaft bewiesen sie einen ausgesprochenen Spürsinn für gute Geschäfte. Zugute kam ihnen ein Netzwerk von Handelsstützpunkten von der Ostsee über die Nordsee und das Schwarze Meer bis zum Mittelmeer.
So wandelten sich die Wikinger von gefürchteten Seeräubern zu respektierten Geschäftsleuten. Und natürlich nicht zu vergessen jene verwegenen Wikinger, die um 1000 als erste Europäer den amerikanischen Kontinent betraten. Allerdings schauten sie hier nur kurz vorbei, bis zur eigentlichen Entdeckung und Inbesitznahme sollte es noch gut 500 Jahre dauern.Schließlich traten sie in einem weiteren Stadium ihrer erstaunlichen Erfolgsgeschichte als Gründer von Staaten und Reichen in Erscheinung. Nur hießen sie da nicht mehr Wikinger, sondern Waräger und Normannen. Als Waräger betrieben sie zusammen mit den Slawen eine außerordentlich rege Siedlungspolitik in Osteuropa und standen Pate bei der Gründung der Fürstentümer von Kiew und Moskau. Die Normannen eroberten 1066 von der nach ihnen benannten Normandie aus England, das nun von normannischen Königen beherrscht wurde. Andere Normannen riefen in Süditalien und Sizilien einen monarchischen Staat ins Leben, den später die schwäbischen Staufer beerbten.
Die Wikinger zogen in die Welt hinaus. Doch blieben sie auch immer ihrer skandinavischen Heimat verbunden. Die meisten Spuren finden sich heute in Dänemark. Zum Beispiel in Jelling, in der Nähe von Vejle. Dank vorbildlicher musealer Aufbereitung ist Jelling zu einem Wikinger-Kultort geworden. Hier fühlt man sich ganz in jene Zeit zurück versetzt, als der legendäre Harald Blauzahn, eine Ikone aus der ersten Riege der Wikinger, im 10. Jahrhundert das Königreich Dänemark gründete. Vor der fast 1000 Jahre alten Kirche stehen zwei alte Runensteine als frühe Zeugnisse der Wikinger-Schrift, auf denen erstmals der Name Dänemark genannt wird. Zwei monumentale Grabhügel für den Wikinger-Führer Gorm und und seinen Sohn Blauzahn (später verlegt in den Dom von Roskilde) bilden ein imposantes Ensemble. Blauzahn erlebt heute eine zweite Karriere der besonderen Art: In der englischen Übersetzung Bluetooth steht sein Name in der Informatik für ein Verfahren der Datenübertragung. Eine kluge Wahl, denn als Einiger der häufig zerstrittenen Wikinger und Sifter des Königreiches Dänemark ist dieser Name ein Gütesiegel für Verbindung und Kommunikation. Nur eines ist bis heute ein Rätsel: Warum hieß Blauzahn Blauzahn? Etwa am Ende ganz einfach, weil er einen blauen Zahn hatte? Die Wissenschaft bleibt in dieser wichtigen Frage am Ball ...
Nicht zuletzt hat Jelling ein Supermuseum zu bieten, das keine Wünsche offen lässt und alle Besucher begeistert. Azf die Frage, warum Blauzahn Blauzahn hieß, liefert es auch keine Antwort, dafür aber eine hoch moderne, hoch informative, hoch anschauliche Präsentation jener spannenden und turbulenten Zeit, als das heute so beschauliche Jelling pulsierende Hauptstadt der Wikinger war.



